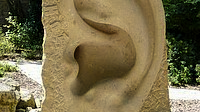Fürsorglicher Zwang und Menschenwürde


Seelsorger in der Psychiatrie sind mit brisanten ethischen Fragen konfrontiert. Unter anderem geht es dabei um Konflikte zwischen Selbstbestimmung und Zwangsmaßnahmen, zu denen auch die Fixierung gehört. Welche Probleme sie selbst identifizieren und wie sie dazu innerhalb der Einrichtungen qualifiziert Stellung beziehen können, das ist Thema des deutschlandweit einzigartigen Praxisforschungsprojektes „Ethik in der Psychiatrieseelsorge“. Das Projekt der Arbeitsstelle Medizinethik in der Klinikseelsorge im Fachbereich Katholische Theologie an der Goethe-Universität wird finanziert von den Bistümern Limburg und Trier. Im Interview berichtet die Theologin Dr. des. Gwendolin Wanderer von der Zielsetzung und ersten Ergebnissen.
Um was geht es bei dem auf zwei Jahre angelegten Projekt?
Wir wollen die Frauen und Männer, die in der Psychiatrieseelsorge tätig sind, in ihrem Engagement für einen menschenwürdigen Umgang mit den Patientinnen und Patienten unterstützen. Dafür werden Weiterbildungsmodule entwickelt und im Rahmen des Projektes veranstaltet. Um den konkreten Bedarf zu ermitteln, haben wir in einem ersten Schritt 29 Psychiatrieseelsorger nach den aus ihrer Sicht besonderen Herausforderungen befragt. Davon sind 24 in den Bistümern Limburg und Trier tätig. Von den übrigen fünf sind zwei in psychiatrischen Einrichtungen der Alexianer tätig und drei sind Seelsorger aus der evangelischen Kirche Hessen und Nassau.
Welcher Art sind die ethischen Fragen in der Psychiatrie, die benannt wurden?
„Fürsorglicher Zwang“ lautet das entscheidende Stichwort. Es geht um das Spannungsfeld von Freiheit und Fürsorge. Psychisch kranke Menschen können in ihrer Selbstbestimmungs- und Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sein. Oft fehlt die Krankheitseinsicht, obwohl Krankheit objektiv gegeben ist. Dann geht die Behandlung gegen die eigene Intuition der Betroffenen. Die Behandlung mit pharmakologischen Medikamenten hat eine besondere Eingriffstiefe. Wenn ein Patient für eine solche Behandlung fixiert wird, hat diese Behandlung eine besondere Brisanz. Damit einher gehen Fragen nach der Menschenwürde und der grundsätzlichen Freiheit des Betroffenen. In den Interviews wurden darüber hinaus die Auswirkungen des Pflegemangels genannt, die hier besonders gravierend ausfallen angesichts von Menschen, die einen besonderen Bedarf an Zuwendung haben. Ein Begriff, der oft genannt wurde, war der der „Drehtürpatienten“ und die Beobachtung, dass der Ton diesen Patienten gegenüber manchmal rauer ist, oft schon an der Pforte. Seelsorger sind sensibel für die Art der Kommunikation.
… Und sie sind nicht in Behandlung und Pflege eingebunden
Das stimmt, sie müssen in diesen Bereichen keine Verantwortung tragen und dürfen gerade einen anderen Blick haben. In der Regel haben sie keinen Einblick in die Krankenakten. Einige Seelsorgende wollen das auch gar nicht. Ich habe in den Interviews gelernt, dass es sehr unterschiedliche Haltungen gibt. Manche sagen, dass sie sogar ganz bewusst Abstand zu Ärzten und Pflegepersonal wahren, um das Vertrauensverhältnis zu den Patienten nicht zu gefährden. Sie möchten aber durch einen etwas anderen Umgang mit den Patienten zeigen, wie es auch gehen könnte, in der Hoffnung, dass ihr Kommunikationsstil als Modell funktioniert. Andere sind aus Überzeugung ganz nah am Behandlungsteam. Auch sie wollen, dass die Patienten ihnen vertrauen, möchten aber auch die andere Seite verstehen. Sich Gehör verschaffen, die ethischen Fragen mitbearbeiten, das geht natürlich besser, wenn man in den Strukturen drin ist. So oder so hat die Seelsorge eine besondere Position, die einerseits schwierig ist, zugleich große Chancen bietet, etwas zu bewirken in der Psychiatrie, weil sie als Profession von außen kommt, andere Impulse setzen kann und für einen ganzheitlichen Blick sorgt.
Wie funktioniert auf der Behandlungs- und Leitungsebene die Zusammenarbeit?
In den Gesprächen ist deutlich geworden, dass ganz viel von der Klinikleitung abhängt. Sie entscheidet, „welcher Wind in der Einrichtung weht“. Da gibt es die ganze Palette – von interprofessionell besetzten Ethikkomitees, zu denen auch die Seelsorger gehören, bis hin zu Kliniken, in denen die Zuständigkeit der Seelsorge einzig in den Bereichen Gottesdienst und Gebet gesehen wird. Das ist ein spannendes Feld, auch deswegen, weil die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Seelsorge lange Zeit spannungsreich war. Man hat sich gegenseitig nicht anerkannt gefühlt, in Bezug auf „Heilung“ bestand mitunter ein Konkurrenzverhältnis. Das Seelsorgekonzept hat sich inzwischen verändert, aber das ist nicht immer und überall bis zu den Ärzten durchgedrungen. Zum Beispiel wird befürchtet, dass die Seelsorger sich in die medikamentöse Behandlung einmischen und den Patienten die Tabletten „ausreden“ könnten. Das machen sie sicher nicht, aber sie haben eventuell einen kritischen Blick auf die Dominanz der medikamentösen Behandlung und sehen zum Beispiel die Notwendigkeit einer intensiveren therapeutischen Begleitung.
Wie sieht denn die seelsorgliche Aufgabe aus?
Erst einmal gilt für Seelsorger der Grundauftrag, sich auf die Seite der Armen zu stellen, der Schwächsten, und das sind im asymmetrischen Kliniksystem die Patienten. Die treten auch ihrerseits mitunter offensiv an die Seelsorger heran mit der Bitte: „Helfen Sie mir, ich werde hier nicht gehört.“ Oder auch: „Ich muss hier raus.“ Zugleich werden Seelsorger umgekehrt zu „schwierigen“ Patienten geschickt, die sich nicht „systemkonform“ verhalten. Sich in diesem Gefüge nicht instrumentalisieren zu lassen, ist ein Balanceakt und eine große Herausforderung. Seelsorgerinnen und Seelsorger können Übersetzer sein, im besten Fall in beide Richtungen. Sie können die Wertvorstellungen der Patienten vermitteln, aber umgekehrt auch dem Patienten die strukturellen Bedingungen der Einrichtungen erklären. Grundsätzlich setzt sich zur Beschreibung ihrer Arbeit mehr und mehr der Begriff des „Empowerment“ durch: Dass Patienten bestärkt werden in ihren Identitätsfragen, wer sie eigentlich sind, was für sie ein gutes Leben ausmacht. Dabei werden Heilungskräfte mobilisiert im Sinne von Selbststärkung. Eine psychische Krankheit verunsichert den Betroffenen grundlegend, sie schüttelt seine Identität regelrecht durch. Der Heilungsprozess ist oftmals langwierig; manche Krankheitsverläufe sind auch chronisch. Es gibt ein großes Leiden in der Psychiatrie! Und im Zusammenhang mit der Behandlung ploppen ethische Fragen auf.
Was brauchen Seelsorger, um damit kompetent umzugehen?
Eine Intention unseres Projektes ist es, sie sprachfähiger werden zu lassen in dem, was sie selbst machen oder auch nicht, was ethisch brisant ist in ihren Augen. Sie brauchen darüber hinaus Fachwissen, um sich in den Einrichtungen Gehör verschaffen zu können. In der Fortbildung wird es unter anderem um unterschiedliche Menschenbilder gehen und um die Identifizierung ethischer Fragen: Wann fängt zum Beispiel Zwang an? Das zu versprachlichen ist anspruchsvoll, denn die Sprache der Ethik ist die Sprache der Philosophie. Ein Modul soll so konzipiert sein, dass es für alle Seelsorger, auch außerhalb der Psychiatrie, interessant ist. Schwerpunkt wird dabei der Umgang mit psychisch Kranken am Ende des Lebens sein. Wichtig ist die Vernetzung untereinander. Wir haben einen Gesprächskreis zur kollegialen ethischen Fallberatung eingerichtet, der sich unter meiner Moderation alle zwei Monate trifft und sehr gut ankommt.
Für wen ist Ihr Kurs gedacht?
Insgesamt können 15 Seelsorgende teilnehmen, vorrangig aus den Bistümern Limburg und Trier, aber auch aus dem ganzen Bundesgebiet. Willkommen sind auch Interessierte aus der evangelischen Kirche. Start ist im November. Wir hoffen darauf, dass die Absolventen ihrerseits wieder als Multiplikatoren wirken. Ich denke, dass die Seelsorgearbeit in der Psychiatrie bedeutsam ist und gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Aber sie ist auch eine große Herausforderung und braucht Unterstützung.
Zur Person: Gwendolin Wanderer ist seit 2009 wissenschaftliche Koordinatorin der Arbeitsstelle "Medizinethik in der Klinikseelsorge", die an der Professur für Moraltheologie und Sozialethik angesiedelt ist. Sie ist Mitglied der Kursleitung des Zertifizierungskurses „Medizinethik in der Klinikseelsorge“ und an den Forschungsprojekten der Arbeitsstelle beteiligt. Als erste Vorsitzende des Frankfurter Ethiknetzwerk e.V. ist sie auch mit Fragen der angewandten Medizin- und Pflegeethik befasst und ist durch die Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) zertifizierte Ethikkoordinatorin im Gesundheitswesen. Gwendolin Wanderer studierte an der Goethe-Universität Frankfurt Katholische Theologie, Anglistik und Philosophie für das Lehramt am Gymnasium und absolvierte das zweite Staatsexamen an der Rudolf-Koch-Schule in Offenbach am Main. In ihrer Dissertation befasste sie sich mit medizinethischen Fragen im Kontext von Depression und Melancholie.
Weitere Informationen: Dr. des. Gwendolin Wanderer, Arbeitsstelle Medizinethik in der Klinikseelsorge, Goethe-Universität Frankfurt, Telefon: 069 98 33352, Mail: ethik-in-der-klinikseelsorge@em.uni-frankfurt.de; www.uni-frankfurt.de/78544942/medizinethik.